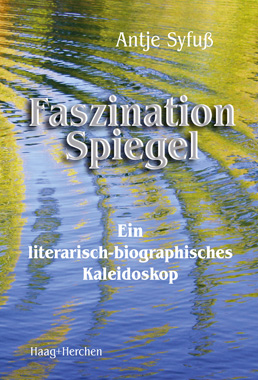 FASZINATION SPIEGEL
FASZINATION SPIEGEL
Ein literarisch-biographisches Kaleidoskop
Frankfurt 2022
Zwölf Geschichten aus der Zeit der Antike bis in die Gegenwart werden hier vorgestellt, die die Autorin in ihrem Leben wie Freunde begleitet und begeistert haben. Überall stehen Spiegel in großer Variationsbreite mehr oder weniger im Zentrum des Geschehens.
Sehr häufig suchen die Personen im Spiegelbild Selbsterkenntnis – und werden enttäuscht. Da ist das Urbild: Ovids Narziss, so wie Faun und Braut auf den schönen, erzählenden Bildern der Mysterienvilla in Pompeji, Sneewittchens Stiefmutter, Kellers ›Grüner Heinrich‹, Thomas Manns Künstler Aschenbach und Bachmanns Undine.
Im Spiegel erscheint aber auch die Welt. So in Platons ›Höhlengleichnis‹ als Schritt zur Klarheit, in der Sage von Perseus und Medusa als Bild des Monsters; Venedig hält für Aschenbach Spiegel- und Zerrbilder bereit. Durch die Spiegelbilder werden Helden manchmal zum Handeln angeregt: Perseus zum Guten, die Stiefmutter zum Bösen. Der Grüne Heinrich tut – nichts. Eine ganz andere Verwendung von Spiegelungen lässt sich in Wolfram von Eschenbachs ›Gawan‹-Erzählung im ›Parzival‹ und in Schlegels ›Athenaeum-Fragment 116‹ ausmachen: In beiden Texten dient ein Spiegel zur Strukturierung des Handlungsverlaufs bzw. des Inhalts. Nicht weniger kunstvoll erscheint in Schillers ›Wilhelm Tell‹ die Natur als Spiegel der Handlung. Für all diese Geschichten schafft der junge Kafka mit der Spiegelung einer Regenwolke den magischen Raum für die Kunst des Erzählens und Zuhörens.
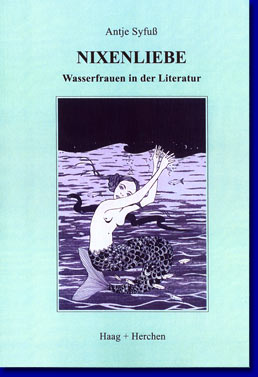 NIXENLIEBE
NIXENLIEBE
Wasserfrauen in der Literatur
Frankfurt 2006
Nixen sind Wasser-Phantasiewesen, die aus den alten Zeiten einer animistischen Religiosität auf uns gekommen sind. Sie sind als die Große Mutter zugleich gut und furchtbar und erscheinen in ihrer wunderbaren Zwiegestalt und ihrem Doppelwesen in alten europäischen Sagen und Märchen.
Spannend ist es, wie die (nicht nur deutschen) Dichter die Wasserfrauen zu handelnden Personen in ihren Texten machen. Die Klassiker sehen in ihnen die Verkörperung der großen Mutter Natur (Goethe) oder der Gefährdung der Freiheit (Schiller); den Romantikern sind sie ein Spiegel ihrer eigenen Zerrissenheit (Brentano) und den nachfolgenden Dichtern des 19. Jahrhunderts ein Bild der Gefährdung (Heine) und der Gespaltenheit der Seele (Keller). Sie stehen aber auch für die Sehnsucht nach Liebe und einer Seele (Andersen) und für Gefühlsverlust und Resignation (Fontane). Schließlich leuchten sie als das ferne Land der Kunst (Mörike, Meyer).
Auch im zwanzigsten Jahrhundert begegnen sie dem Leser in erstaunlicher Variationsbreite. So verführen sie im Werk Thomas Manns ihre Partner bis hin zur androgynen Einheit oder locken zu Liebe und Erkenntnis für eine Nacht (Bachmann).
Zeitgenössische Texte zeigen eine Nixe, die mit Hilfe der Medizin eine Frau werden will (Domhardt) und eine Frau, die in ihrer Phantasie eine Nixe sein will (Hunt).
Die Texte dieser und weiterer Dichter werden präsentiert und in verschiedenen Interpretationsansätzen gedeutet. In ihnen wird deutlich: Der alte Mythos ist aktuell und erneuert sich durch die Faszination des Lebenselements Wasser.
Die Kapitel:
Einleitung
Rollenzuweisungen
Anfang und Ende eines Mythos
Die Sirenen
Homer
Franz Kafka
Die Namenlosen
Brüder Grimm
Märchen aus der Oberpfalz
Otto Sutermeister
Die Sagenhaften
Loreley: Joseph Freiherr von Eichendorff, Clemens Brentano, Exkurs: Friedrich Schlegel, Heinrich Heine: drei Gedichte
Melusine: Thüring von Ringoltingen, Johann Wolfgang Goethe,Theodor Fontane
Undine: Friedrich de la Motte-Fouqué, Albert Lortzing, Jean Giraudoux, Ingeborg Bachmann
Die Unerreichbaren
Tod in der Tiefe: Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, Conrad Ferdinad Meyer
Gottfried Keller: Der grüne Heinrich, drei Gedichte
Paul Heyse
Franz Kafka: Der Proceß
Die Sehnsüchtigen
Eduard Mörike: zwei Texte
Die kleine Seejungfrau:: Hans Christian Andersen, Oscar Wilde, Walt Disney
Elke Domhardt
Samantha Hunt
Die Wandlungsfähigen bei Thomas Mann
Die kleine Seejungfrau: Tonio Kröger, Königliche Hoheit, Dr. Faustus
Loreley: Unordnung und frühes Leid, Felix Krull (früher Teil)
Aphrodite / Venus: Felix Krull (später Teil)
Ausblick: Ea-Oannes in: Joseph und seine Brüder
Die Komischen
Kurt Schwitters
Peter Rühmkorf
Belmondo Schuhwerbung
Nachwort
Der Mythos von den Nixen und Wasserfrauen
Eine Studie zu Thomas Mann
Frankfurt 1993
Thomas Manns Romane Königliche Hoheit und Joseph und seine Brüder werden auf Besonderheiten der literarischen Verwendung von Märchen hin betrachtet. Der Erzähler nutzt sie zur Gestaltung von Personen und Situationen in immer neuen stilistischen Varianten. Darüber hinaus stützt in dem frühen Werk das zugrundeliegende Märchenschema die Heiterkeit des Romans, während der dritte und vierte Band des Josephsromans durch die Märchenstruktur verbunden erscheinen. Eine diachrone Untersuchung des Motivs der Nixen und Wassergeister erweist Thomas Manns lebenslange Beschäftigung mit Märchen. Sie zeigt in ihrer Variationsbreite Ironie als Haltung der Humanität.
Die Kapitel
Kapitel I
Volksmärchen und Kunstmärchen
Märchen als Herausforderung des Schriftstellers Thomas Mann
Kapitel II
Königliche Hoheit
Vorspiel
Offenes Spiel mit Märchen: Personen und Prophezeiungen
Verdecktes Spiel mit Märchen: Räume
Struktur unter Märchenaspekten
Ellipse und Synthese
Kapitel III
Der Josephsroman
Poetologie des Märchens im Josephsroman
Jaakob: Zauber und Wunder
Joseph und seine Brüder: Amor und Psyche
Joseph und Mut: Schneewittchen und Kleine Seejungfrau
Joseph: Der Held des Brüdermärchens
Schilo und Serach: noch einmal Schneewittchen
Die Funktionen des Märchens im Josephsroman
Kapitel IV
Nixen und Wassergeister
Vorbemerkungen
Einzelanalysen: Buddenbrooks, Gladius dei, Tonio Kröger, Fiorenza,
Wälsungenblut, Anekdote, Königliche Hoheit, Felix Krull, Der Tod in Venedig, Der Zauberberg, Unordnug und frühes Leid, Joseph und seine Brüder, Lotte in Weimar, Doktor Faustus, Felix Krull, Die Betrogene
Tendenzen und Motivationen der Verwendung des Nixen-Motivs